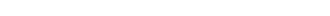Statusobjekt Visitenkarte – Nicht von Pappe
85 mal 54 Millimeter:
Viel passt nicht auf Visitenkarten. Was vor 200 Jahren als Besucherkarte begann, wurde zum Statussymbol von Managern. Heute ist die Pappe vielen nicht mehr so wichtig. Was Firmen unterschätzen: Die Kärtchen sind gut für die Unternehmenskultur.
Eigentlich kein Wunder, dass ausgerechnet jene beiden Männer ihre Visitenkarten anfangs nicht so wichtig nahmen, die die digitale Welt revolutionierten: Die frühen Businesscards, die von Google-Gründer Larry Page und dem verstorbenen Apple-Boss Steve Jobs kursieren, sind eher schäbig. Die eine war wohl Ende der Neunziger Jahre in Gebrauch, die andere stammt angeblich von 1979. So etwas bekommt man heute in jedem Bahnhof zum Selbstausdrucken.
Eigentlich ist es ja nur ein Stück Pappe, standardmäßig im Format 85 mal 54 Millimeter, Scheckkartengröße eben. Aber die Wirkung ist enorm – Visitenkarten haben den Rang einer eigenen Währung: Wer am meisten auf einem Businesstermin sammelt und verteilt, der darf sich umso wichtiger fühlen. Regelmäßig sieht man Geschäftsleute, die am Flughafen ihre Wartezeit damit verbringen, erst einmal zentimeterdicke Packen von Visitenkarten zu sortieren und auf der Rückseite ein paar Notizen zur Person zu machen.
Es war in den neunziger Jahren, als die Karte zum Statussymbol in der Kaste der Führungskräfte wurden. Der Rang eines Geschäftsmanns ließ sich nun nicht mehr nur daran ablesen, in welchem hippen Restaurant er einen Tisch bekam – sondern an der Papierqualität seiner Businesscard. Man denke nur an die berühmte Visitenkarten-Szene in der Verfilmung von Bret Easton Ellis‘ Roman „American Psycho“. Überhaupt: In Filmen und TV-Serien gehören die Dinger nach wie vor fest zur Ausstattung von Businesstypen.
Keiner nimmt sie mehr ernst
Von Statussymbolen sind die Karten heute zumindest in Deutschland weit entfernt, auch weil mittlerweile fast nur noch digitale Kontaktdaten ausgetauscht werden. Schade sei das, findet Grafiker Rayan Abdullah, der sich mit seiner Agentur auf Corporate Design spezialisiert hat. „Die meisten nehmen Visitenkarten nicht ernst“, sagt Abdullah, „viele Unternehmer denken, sie sollten genau da sparen.“ Sie übersähen, welche Ausstrahlung das kleine Stück Pappe haben könne. „Über eine Visitenkarte tragen die Mitarbeiter die Identität des Unternehmens nach außen“, sagt Abdullah.
Fast genauso wichtig ist seiner Meinung nach die Wirkung nach innen: „Eine Visitenkarte stärkt das Wir-Gefühl in einem Unternehmen“, die Loyalität nehme zu. Es sei gut für die Unternehmenskultur, findet er, wenn jeder, selbst der Arbeiter hinter der Maschine, seinen eigenen Packen Visitenkarten bekomme.
Denn sie spiegeln das Image eines Unternehmens wider – ihr Design muss zur Marke passen. Gerade bei kleinen Betrieben oder Selbständigen nimmt das extreme Formen an: Sie entwerfen regelrechte Themenkarten – die des Radiomoderators ist geformt wie ein Mikrofon, die der Bäckerei sieht aus wie ein Keks. Eben Hauptsache auffallen, um über den Look der Karte etwas von der eigenen Persönlichkeit zu transportieren. So wie der Werber Jeff Greenspan, zuletzt Chefstratege bei Facebook und jetzt Oberkreativer bei der Social-News-Site Buzzfeed: Er hat sich auch schon eine Visitenkarte mit Bonuspunktesystem entworfen.
Welch absurde Blüten das aber auch treiben kann, sieht man am Coaching-Wanderprediger Joel Bauer, der nach eigenen Angaben 25 Jahre brauchte, um die „perfekte Karte“ zu entwerfen – die aber mit ihrem bizarren Faltsystem jede Praktikabilität außer Acht lässt.
Richtig wichtig nimmt man die Businesscards noch in Japan, die Visitenkartenkultur ist entsprechend ausgeprägt. Dort drückt sich die Ehrerbietung dem Geschäftspartner gegenüber sogar darüber aus, wie man sich die Karten reicht: Bitte das gute Stück nur an den Ecken anfassen, dabei das Firmenlogo keinesfalls mit den Fingern zudecken, Verbeugung inklusive.
Auf dem Silbertablett serviert
So typisch die Karten heute fürs Geschäftsleben sind, so wenig hatten sie vor 200 Jahren damit zu tun, als die Tradition des Kärtchenverteilens begann. Besucher überbrachten sie, um, na klar, ihre Visite anzukündigen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurden sie in Europa populär, und zwar nicht nur beim Adel. „Besuchskarten“ hießen sie in ihrem damaligen Gebrauch auf Deutsch, „Calling Cards“ im Englischen.
Die Karten hatten damals in etwa die Funktion von Anrufbeantworternachrichten oder SMS heute: Es ging schlicht darum, bestimmten Leuten mitzuteilen, dass man angekommen sei oder bald wieder abreisen würde. Man kennt die Szene aus Kostümfilmen, das gesamte Werk Jane Austens ist voll davon: Ein Mann kommt in ein fremdes Haus, legt seine Karte auf ein Silbertablett, das dann zur Herrschaft getragen wird. Und dann wird der gute Mann vorgelassen – oder eben nicht.
Das Design der Karten hing vom Status ab: Für Männer gab es kleinere, weil sie in die Westentasche oder in aufwendig gestaltete Dosen passen mussten. Vorgedruckte Namenskarten ohne Rüschenkram etablierten sich erst im 19. Jahrhundert. Überhaupt: Im Gegensatz zu heute kam es nur auf den Namen an, eventuell die Adresse falls ein Gegenbesuch erwünscht war – oder zumindest eine Nachricht.
Aber man muss gar nicht so weit zurückschauen, um eine veränderte Mode festzustellen – ein, zwei Jahrzehnte reichen schon: „Da waren Visitenkarten fast schon kleine Flyer“, kommentiert Grafiker Rayan Abdullah etwas abfällig den „ganzen Schnickschnack“. Eine Visitenkarte sei schließlich „keine Zeitung und auch keine Zeitungsbeilage“. Aus rein grafischen Gesichtspunkten passe in das Format nun einmal nur eine bestimmte Menge an Informationen. „Eine volle Visitenkarte hinterlässt einen schlechten Eindruck“, findet er.
Wer einen schnellen Tipp vom Profi braucht: Von der immergleichen Mischung aus Name, Funktion, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, schwarz auf weiß, hält Abdullah übrigens nichts. Seine Karte ist rot. Und hat nur ein einziges Wort aufgedruckt: die Adresse seiner Homepage.
Quelle: Spiegel.de – KarriereSPIEGEL-Autorin Anne Haeming